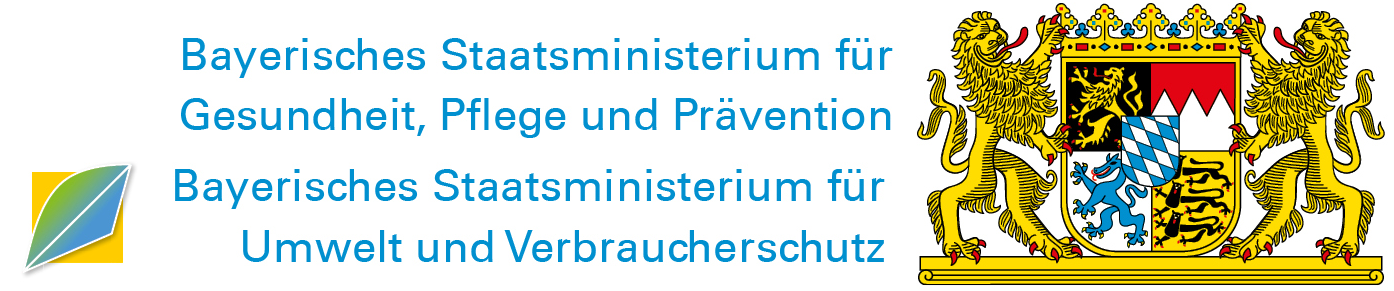Leistungsfähigkeit im Klimawandel sichern (LeiKs)
Ludwig-Maximilians-Universität München
Hintergrund und Ziel des Projekts
Die Anzahl von hitzebedingten Arbeitsunfähigkeitstagen (ICD-10 T67) hat sich mit ca. 20.000 im Jahr 2008 und ca. 80.000 im Jahr 2018 vervierfacht; auch hitzebedingte Einbußen in Leistungsfähigkeit und Arbeitsproduktivität sind nachweisbar. Im Bereich Klima- und Hitzeresilienz, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden während des Ausübens von Bürotätigkeiten bestehen erhebliche Forschungslücken, ebenso bei der Betrachtung von Wechselwirkungen zwischen Wohn- und Arbeitsumgebung bei Hitze – ein Aspekt, der vor dem Hintergrund der Verlagerung von Arbeitszeiten in den Wohnbereich (Homeoffice) an Relevanz gewinnt.
Das Projekt LeiKs hatte zum Ziel:
- Erfassen der Wechselwirkungen zwischen Temperaturbelastungen im Büro- und Wohnbereich, indem die Hitzebelastung und verschiedene gesundheitliche und leistungsbezogene Indikatoren bei Büroarbeitenden erhoben werden
- Identifizieren von Risiko- und Resilienzfaktoren jenseits der energieintensiven Klimatisierung
- Befähigen relevanter Akteurinnen und Akteure hinsichtlich Risikokommunikation und effektiver Hitzeschutzmaßnahmen im Bürobereich durch zielgruppenspezifische Formate wie Leitfäden oder Bildungsmodule
- Bereitstellung der Projektergebnisse als Bausteine für Klimaanpassungskonzepte und Hitzeaktionspläne für Kommunen, weitere Branchen, Sektoren und Bevölkerungsgruppen
- Wissenschaftspraxisdialog durch den Aufbau eines breiten Netzwerkes mit Vertreterinnen und Vertretern relevanter Verbände und Institutionen
Relevanz des Projektes für Praxis und Politik (v. a. in Bayern)
Intensität und Häufigkeit von Hitzeereignissen nehmen auch in Bayern stark zu, der Bedarf an Anpassungsmaßnahmen steigt in allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Mit seinem Fokus auf Bürobeschäftigte leistet das Vorhaben einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen Anpassung an den Klimawandel in Bayern, da ein Großteil der Erwerbstätigen seine Tätigkeit im Büro ausübt.
Methoden
Durch Methoden aus (Umwelt-)Soziologie, Arbeitsmedizin und anderen Wissenschaften wie Psychologie und Mikroklimatologie kann das Forschungsprojekt interdisziplinär verschiedene für Gesundheit und Leistungsfähigkeit relevante Parameter erfassen. Durch die transdisziplinäre Zusammenarbeit mit Schlüsselakteuren aus der Praxis wird zudem die praktische Relevanz und Übertragbarkeit der Projektergebnisse sichergestellt.
Es kommen u.a. Methoden des Stakeholdermapping zum Einsatz ebenso wie Temperaturmessungen, Fragebogenerhebungen und qualitative Methoden wie Tagebuch- und subjektive Kartierungsmethoden. Zur Identifizierung von Risiko- und Resilienzfaktoren werden multivariate Daten- und qualitative Inhaltsanalysen durchgeführt. Die entwickelten Leitfäden zur Risikokommunikation werden in intensivem Austausch mit den assoziierten Praxispartnern entwickelt und validiert.
Projektfortschritte
Es wurde ein Projektbeirat u.a. mit bayerischen Kommunen unterschiedlicher Größe, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, der IHK für München und Oberbayern, dem Deutschen Wetterdienst und weiteren Forschungs- und Praxisakteuren gebildet. Der Projektbeirat wurde in alle wichtigen Schritte des Projekts eingebunden.
Im Frühjahr und während zweier Hitzeperioden im Sommer 2023 wurden über 200 Teilnehmende aus 20 Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen befragt und Temperaturen an ihren Wohn- und Arbeitsorten kontinuierlich gemessen.
Die Temperaturmessungen ergaben, dass der größte Teil der „konventionellen“, d.h. nicht mechanisch gekühlten Büros, den in der Arbeitsschutzrichtlinie ASR 3.5 angegebenen Grenzwert von 26 °C – ab dem „effektive Hitzeschutzmaßnahmen“ vom Arbeitgeber getroffen werden sollen – dauerhaft überschreitet. Die strengere Temperaturgrenze von 30 °C hingegen wird von den meisten Büros noch nicht systematisch überschritten. Die Messungen zeigen auch, dass Arbeitsplätze zuhause weniger stark von Hitze betroffen sind. An den Homeoffice-Arbeitsplätzen wurde zusätzlich zur Lufttemperatur auch die Luftfeuchtigkeit gemessen. Diese liegt ganz überwiegend im Rahmen internationaler Richtlinien für den Sommer.
Im Verlauf der Hitzeperioden zeigte sich, dass die empfundene Leistungsfähigkeit und das gesundheitliche Wohlbefinden der Teilnehmenden deutlich abnehmen. Dies ging einher mit sinkender Arbeitsfreude und geringerer Anstrengungsbereitschaft. Es zeigte sich auch ein deutlicher Effekt im Tagesverlauf: während der Hitzeperiode fühlten sich viele Teilnehmende nur noch am Vormittag leistungsfähig und fielen nachmittags vollständig ab. Viele Befragte waren während einer Hitzewelle zudem weniger ausgeglichen, stattdessen nervöser und weniger ausgeruht. Die Schlafqualität und Erholung wurden reduziert und auch hitzebedingte Beschwerden wie geschwollene Beine, starkes Schwitzen und Kopfschmerzen nahmen deutlich zu. Die Schlafzimmer waren allerdings nicht merklich überhitzt und in von den Teilnehmenden selbst durchgeführten Messungen wurden kaum gesundheitlich bedenkliche Körperkerntemperaturen von über 37,3 °C verzeichnet.
Bei den hitzebedingten Folgen spielten sowohl individuelle Eigenschaften wie Temperaturvorlieben oder Vorerkrankungen, aber auch strukturelle Faktoren wie etwa Lage, Hitzeschutz-Ausstattung der Büros sowie organisatorische Aspekte (Arbeitszeiten, Homeoffice-Regelungen) eine zentrale Rolle. Durch die niedrigeren gemessenen Temperaturen und die im Mittel höhere Zufriedenheit konnte insbesondere die Möglichkeit zur flexiblen Homeoffice-Tätigkeit als Resilienzfaktor identifiziert werden. Es konnten hingegen keine statistisch signifikanten Effekte des Arbeitsweges oder der mikroklimatischen Lage festgestellt werden.
Die Untersuchung zeigte auch, dass Gesundheitsrisiken durch Hitze vor allem in Innenräumen häufig unterschätzt und Schutzmaßnahmen nicht konsequent umgesetzt werden. Deshalb ist es wichtig, Informationen und Verhaltenshinweise bereitzustellen und gezielt zu verbreiten. Sie sollten dabei möglichst gut in den Arbeitsalltag und das Arbeitsumfeld integriert sein. Gemeinsam mit einer Vielzahl von Partnern aus Wissenschaft und Praxis wurden im Projekt daher entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet und werden als Broschüre und Folder allen interessierten Unternehmen und Beschäftigten zur Verfügung gestellt.
Die Ergebnisse wurden im Rahmen wissenschaftlicher Konferenzen und Vorlesungen, Fachtagungen, öffentlicher Vorträge sowie in verschiedenen Publikationen präsentiert.
Handlungsempfehlungen für die Praxis
Die Handlungsempfehlungen zum Hitzeschutz in der Praxis sind frei zum Download verfügbar.
Die Produkte können als Leseversion oder als Druckversion heruntergeladen werden.
Die Druckversion kann als hochauflösende Druckvorlage für eigene Printprodukte verwendet werden.
Die 16-seitige Broschüre „Hitzeschutz im Büro“ richtet sich an Arbeitgeber, zuständige Führungskräfte und Entscheider sowie Entscheiderinnen in Betrieben.
- Leseversion Broschüre „Hitzeschutz im Büro – Handlungsempfehlung für Betriebe“ (PDF, 2,8 MB)
- Druckversion Broschüre „Hitzeschutz im Büro – Handlungsempfehlung für Betriebe“ (PDF, 5 MB)
Der Folder richtet sich an Beschäftigte und zeigt Informationen und Tipps für Hitzeschutz am Arbeitsplatz auf.
- Leseversion Folder „Hitzeschutz im Büro – Informationen und Tipps für Mitarbeitende“ (PDF, 1,2 MB)
- Druckversion Folder „Hitzeschutz im Büro – Informationen und Tipps für Mitarbeitende“ (PDF, 2,7 MB)