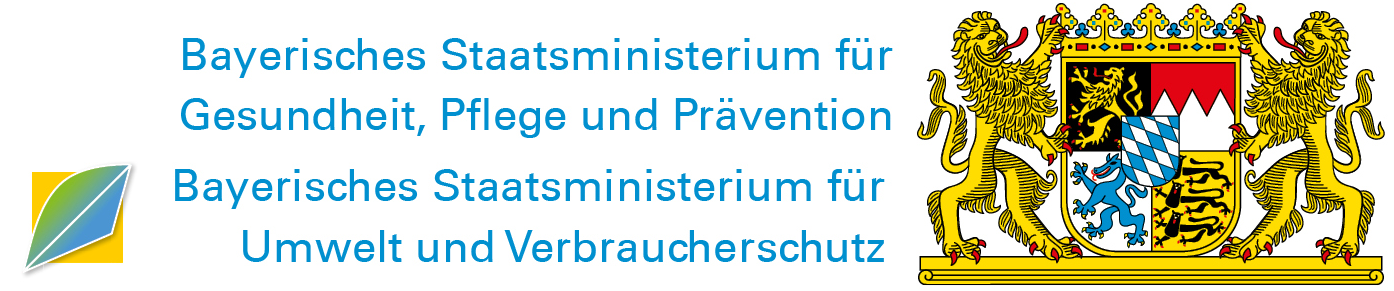Resilienz durch Kulturlandschaft im Klimawandel (REKKE)
Universität Nürnberg-Erlangen
Hintergrund und Ziel des Projekts
Die klar vorhersehbaren Auswirkungen des Klimawandels in Bayern umfassen insbesondere länger anhaltende Hitzephasen im Sommer. Da diese lange nachwirken, steht Kulturlandschaft in ihrer alltäglichen resilienzstiftenden und gesundheitsfördernden Wirkung für die Bevölkerung vor großen Herausforderungen. Es geht dabei nicht nur um den Verlust einer vertrauten ästhetischen Qualität, sondern um konkrete Einschränkungen als Erholungsort, Ort sozialer Teilhabe und Raum für körperliche Aktivität und Sport. Dies betrifft die Nutzbarkeit des heimischen Balkons genauso wie sommerliche Freiluftveranstaltungen oder die wöchentliche Walking-Gruppe im nahen Wald. Die Folgen des Klimawandels treffen dabei nochmals verstärkt vulnerable Bevölkerungsgruppen, die aufgrund von Barrieren wie reduzierter Mobilität, begrenzter finanzieller Ressourcen oder chronischer Krankheiten ohnehin nur eingeschränkten Zugang zu gesundheitsfördernden Kulturlandschaftselementen haben. Vor diesem Hintergrund stellen wir folgende, bisher nicht adressierte Forschungsfragen:
- Welche Kulturlandschaftselemente sind dem Klimawandel besonders ausgesetzt?
- Welche Kulturlandschaftselemente sind Stand heute für die individuelle körperliche, mentale und soziale Gesundheit und Resilienz besonders wichtig?
- Welche Maßnahmen können bereits heute eingeleitet werden, damit die gesundheitsfördernde Funktion von Kulturlandschaft von der Bevölkerung auch in Zukunft uneingeschränkt genutzt werden kann?
Primäres Ziel des Projekts ist aufzuzeigen, wie die nachweislich gesundheitsfördernde Wirkung von Kulturlandschaft sowohl in urbanen wie ländlichen Kontexten Bayerns im Klimawandel erhalten werden kann. Die Handlungsempfehlungen dazu umfassen Vorschläge, wie betroffene Kulturlandschaftsflächen geschützt werden können:
- Planerische Anpassungen, insbesondere bzgl. Nutzungsart
- Verhaltensanpassungen im alltäglichen Umgang
- Einbeziehung der lokalen Bevölkerung mit dem Ziel, dass die nötige Anpassung an den Klimawandel nicht als Verlust, sondern als aktiv gestalteter Prozess verstanden wird.
Das Projektergebnis wird über die Dauer der Projektlaufzeit hinaus als digitales Werkzeug verstetigt, in dem die Forschungsergebnisse ortsbezogen und für verschiedene Szenarien visualisiert werden können und der Grad des Impacts auf alltägliche Routinen und individuelles Landschaftserleben auch an zukünftige Forschungsergebnisse angepasst werden kann.
Relevanz des Projekts für Praxis und Politik (v. a. in Bayern)
Durch die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen in einem Mediationsprozess mit kommunalen Akteuren und lokalen Einwohnern in der Pilotregion Oberfranken-West informieren und sensibilisieren wir nicht nur, sondern machen einen Prozessvorschlag, wie die nötige gesamtgesellschaftliche Transformation aktiv gestaltet werden kann (Verbundprojekt Klimawandel und Gesundheit (VKG) Schwerpunkt 4). Die erarbeiteten Handlungsempfehlungen werden zudem im Mediationsprozess auf ihre Machbarkeit geprüft. Insofern das im Projekt entwickelte digitale Werkzeug nach Projektabschluss zum Screening des Verlustrisikos resilienzstiftender Kulturlandschaft auf Bayern angewendet werden kann, tragen wir zum Monitoring klimabedingter Veränderungen gesundheitsrelevanter Umweltparameter bei (VKG Schwerpunkt 3). Das Projekt adressiert zudem die Ziele der Klimaschutzoffensive der bayerischen Staatsregierung.
Methoden
Downscaling von globalen Prognosen auf Bayern
Ziel der Berechnung angepasster regionaler Klimamodellen für Bayerns nähere Zukunft ist das Schaffen eines Erwartungsrahmens der veränderten klimatischen Bedingungen, denen die bayerische Kulturlandschaft in den kommenden Jahrzehnten ausgesetzt sein wird.
Typische Verläufe von Hitzewellen
Ziel der Bestimmung des prototypischen Verlaufs von Hitzephasen ist die Ermittlung von Kipppunkten, die angeben, ab welchem Tag einer Hitzephase sich die Ausbildung gut sichtbarer Beeinträchtigungen in der Kulturlandschaft rapide beschleunigt.
Abgleich von Landnutzung und Kulturlandschaftsflächen
Auf Basis bestehender Kulturlandschaftsinventare wird ermittelt, welche dieser Elemente durch langanhaltende Hitzephasen besonders betroffen sein werden. Unter Berücksichtigung stützender Nutzungen (öffentlich, gewerblich oder touristisch) wird auf dieser Grundlage die Vulnerabilität der jeweiligen Flächen abgeschätzt.
Ermittlung der besonders gesundheitsfördernden Flächenarten
Durch Befragungen in der lokalen Bevölkerung wird bestimmt, welche Kulturlandschaftsflächen für die Gesundheit der Bevölkerung unerlässlich sind. Dabei ist für die Generalisierung des Ansatzes entscheidend, dass die Ergebnisse nicht auf konkrete Orte, sondern auf bestimmte Flächenarten bezogen werden.
Ermittlung des Verlustrisikos
Eine Risikomatrix kombiniert (1) hohe Ausgesetztheit (klimageographische Exposition), (2) hohe Anfälligkeit (sozioökonomische Vulnerabilität) und (3) hohe Bedeutung für die individuelle Resilienz zu einer globalen Risikoabschätzung.
Entwickeln von Handlungsempfehlungen
Im Mediationsprozess mit kommunalen Stakeholdern und der ortsansässigen Bevölkerung wird ermittelt, welche Maßnahmen zu den Anpassungen von Kulturlandschaft an die vorhersehbaren klimatischen Bedingungen heute schon möglich und leicht umsetzbar sind.
Projektfortschritte
Auf Grundlage regional abgestimmter Klimamodelle und Satellitendaten der vergangenen Dekade wurde ein Modell zur Abschätzung der Folgen sich intensivierender Hitzephasen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auf die lokale Umwelt erstellt.
Zur genaueren Abschätzung der von den abzusehenden Veränderungen betroffenen Gesellschaftsbereiche wurden Stakeholder-Interviews in Stadt und Landkreis Bamberg durchgeführt, um bereits wahrnehmbare Veränderungen in der Landschaft und der an sie gebundenen resilienzstiftenden Praktiken zu ermitteln. Um die individuellen Bedürfnisse und Verhaltensweisen gerade auch in sozioökonomisch schwachen Stadtteilen der Stadt Bamberg besser einschätzen zu können, führten wir darauf aufbauend eine Befragung der Bevölkerung zu ihren individuellen Resilienzorten und -aktivitäten durch, um die Flächen mit der höchsten gesundheitsstiftenden Wirkung zu identifizieren. Die individuellen Resilienzorte wurden im Anschluss mit den im Kulturlandschaftinventar Oberfranken-West (Thomas Büttner) erfassten Kulturlandschaftselementen abgeglichen.
In einem offen geführten Mediationsprozess gemeinsam mit Modellkommunen in der Region bewerteten wir zudem individuelle Handlungs- und strukturelle Interventionsmöglichkeiten auf dem Weg zur Klimaresilienz. Zur Stärkung der Vernetzung bereits bestehender Eigeninitiativen im Bereich Klimaanpassung gerade außerhalb der Städte veranstalteten wir dazu gemeinsam mit den beteiligten Gemeinden Oberhaid und Lisberg im Landkreis Bamberg seit Oktober 2023 Nachhaltigkeitstage unter dem Titel „gscheid schlau“. Als zentrale Veranstaltung zur politischen Verstetigung des Projektanliegens veranstalteten wir im Juli 2024 gemeinsam mit dem Landratsamt des Landkreises Bamberg ein Treffen mit 20 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis, um zu den Themen Hitze, Wasser und Eigenvorsorge bekannte Lösungsansätze zu evaluieren und den Transfer bereits etablierter Lösungen zwischen den Gemeinden anzuregen. Die besonderen Bedürfnisse von Kindern konnten wir mit einem Klimatag für 9- bis 11-jährige Kinder in der Gemeinde Oberhaid im Landkreis Bamberg herausarbeiten. Unter dem Titel „Die Klima-Checker“ erkundeten die Kinder an einem (sehr heißen) Aktionstag im Juli 2024 spielerisch angepasstes Verhalten bei Hitze und einen schonenden Umgang mit Trinkwasser.
Erste Ergebnisse wurden bereits im September 2023 auf dem Deutschen Kongress für Geographie sowie auf dem 10. Bayerischen Kongress für den Öffentlichen Gesundheitsdienst präsentiert.