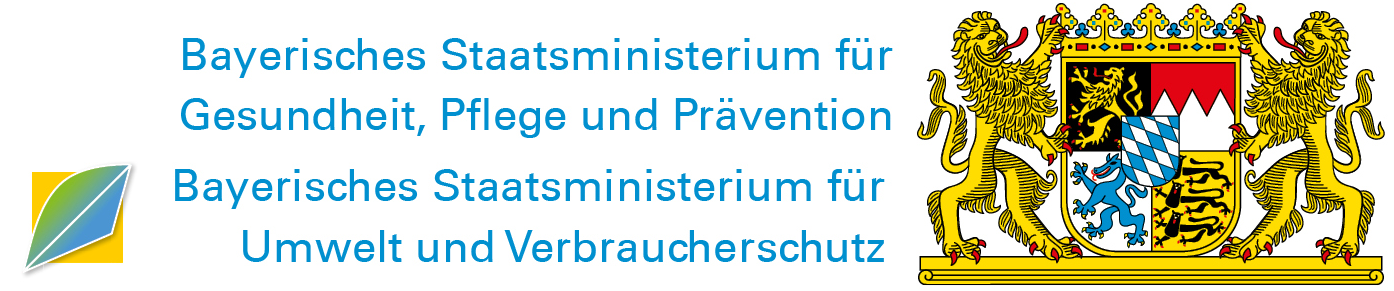Stadtoasen im Klimawandel - Untersuchungen zur sozial-ökologischen Bedeutung von Stadtgrün für das Wohlbefinden (StOasenWandel)
Technische Universität München
Hintergrund und Ziel des Projektes
Städte werden in besonderem Maße von den Auswirkungen des Klimawandels, z. B. durch Starkniederschläge oder längere Hitzeperioden, betroffen sein. Städtische Grünflächen inklusive Bäume, Parkflächen und Wälder werden in diesem Zusammenhang in mehrfacher Hinsicht enorm an Bedeutung gewinnen. Je nach Vegetationsstruktur und Größe entfalten diese Grünflächen biophysikalisch unterschiedliche Wirkungen und tragen u. a. zum Temperaturausgleich bei. Die stadtökologische Bedeutung von urbanen Grünflächen wird in den letzten Jahren zunehmend mit Aspekten der Biodiversität und der nachhaltigen, urbanen Klimaanpassung sowie mit der Gesundheit der Menschen in der Stadt verknüpft, deren Nachfrage nach Erholung in städtischen Grünflächen steigt. Stadtgrün hat das Potential unterschiedliche Auswirkungen des Klimawandels in Städten zu mindern und dabei direkt und indirekt zur Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner beizutragen.
Das StOasenWandel Projekt legt den Fokus auf die sozial-ökologische, gesundheits- und klimabezogene Bedeutung von kleinen Grünflächen: Stadtoasen. Die Bedeutung der Größe und Struktur wird im Hinblick auf mikrometeorologische und gesundheitliche Faktoren untersucht. Wir stellen die Hypothese auf, dass viele kleine Stadtoasen (<1ha) in unseren wachsenden und zunehmend wärmeren Städten eine wichtige Rolle für die urbane Klimaanpassung und die Gesundheitsvorsorge spielen und in Summe eine größere Wirkung entfalten als eine große Stadtoase.
Das Ziel des Projektes ist es zum einen zu untersuchen, welche Effekte von Stadtoasen auf die unmittelbare Umgebung und die menschliche Gesundheit ausgehen können und welche Vegetationsstrukturen sich als vorteilhaft für die gesundheitliche Vorsorge und das gemessene und gefühlte Mikroklima innerhalb der Stadtoasen herausstellen. Zum anderen sieht das Projekt vor, auf Basis der Ergebnisse zielorientierte Handlungsempfehlungen für die zukünftige Grünflächenentwicklung in Städten abzuleiten.
Relevanz des Projektes für Praxis und Politik (v. a. in Bayern)
Für die Praxis in Bayern werden wir Information liefern, wie Stadtoasen: (1) Ausgleichs-, Ruhe- und Begegnungsräume für Stadtbewohner (Gesundheit, Lebensqualität, Wohlbefinden, Naturerfahrung, Lärmreduktion) bietet; und (2) das Stadtklima (Abkühlung) insbesondere an heißen Tagen verbessert. Unsere quantitative Forschung wird Schlüsselinformationen liefern, die in die Planung und Gestaltung städtischer Grünflächen einfließen können. Der partizipative Forschungsansatz, der die Stadt München und die Bürgerinnen und Bürger in den Forschungsprozess einbezieht, ermöglicht eine Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis.
Die Ergebnisse sollen dann als Handlungsempfehlungen für Kommunen und Planer zusammengefasst werden und einen Beitrag zur klimaangepassten Gesundheitsvorsorge und der urbanen Klimaanpassung leisten. Stadtoasen sind sichtbare und wahrnehmbare Zeichen einer nachhaltigen Stadtentwicklung und schaffen Leitbilder für eine zukunftsfähige lebenswertere Stadt in Zeiten des Klimawandels. Die Ergebnisse, die exemplarisch für München entwickelt werden, haben das Potential auf andere Städte in Bayern übertragen zu werden.
Methoden
Das Projekt ist auf Stadtoasen im Stadtgebiet München konzentriert. Als Stadtoasen begreifen wir im Rahmen des Projektes sämtliche Grünflächen, die öffentlich zugänglich sind und ganz oder überwiegend von urbanen Flächen umgeben sind, die dem Transport, Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen dienen. Solche Flächen schließen verschiedene Grünanlagen und Parks ein. Als Referenzflächen sollen drei stadtnahe Waldflächen dienen.
Die Datenerhebung folgt einem inter- und transdisziplinären Ansatz, um gesundheitswirksame, meteorologische (kleinstandörtlich-klimatisch) und ökologische Kenngrößen zu erheben. Dabei kommen v. a. Methoden der empirischen Naturwissenschaften und der partizipativen empirischen Sozialforschung zum Einsatz.
Projektfortschritte
Städtische Grünflächen inklusive Bäume, Parkflächen und Wälder gewinnen im Klimawandel aus Sicht des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung zunehmend an Bedeutung, da sie durch mikroklimatische Regulierung sowie Raum für Naturerleben, körperliche Aktivität, Erholung und soziale Begegnung direkt und indirekt zur Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner beitragen können. Gleichzeitig können Grünflächen wichtige Habitatfunktionen für verschiedene Arten von Pflanzen und Tieren erfüllen. Welche objektiven und subjektiven Charakteristika bedingen die sozialen und -ökologischen Funktionen von Grünflächen, die sie zu multifunktionalen “Stadtoasen” machen? Kleine Flächen mit hoher Strukturvielfalt der Gehölzvegetation – so unsere Annahme – haben in einer wachsenden Stadt wie München, Deutschland, das Potenzial, die Ziele von Klimaschutz und Gesundheitsförderung zu vereinbaren.
Ab Herbst 2024 haben wir interessante Ergebnisse aus unserer empirischen Forschung. Die von uns untersuchten, öffentlichen Grünflächen in der Stadt München zeichnen sich durch eine diverse Vegetationszusammensetzung aus und lassen sich auf dieser Basis in vier Kategorien einteilen. Es gibt Parks mit geringer struktureller Vielfalt, in denen es nur wenige Bäume und Sträucher gibt, Parks mit vielen Bäumen, aber keinen Sträuchern, Parks mit mittlerer struktureller Vielfalt und Parks mit hoher struktureller Vielfalt, die sich durch eine dichte, vielschichtige Vegetation und einen hohen Überschirmungsgrad der Bäume auszeichnen. Während die Münchner Grünflächen im Winter unabhängig von der Vegetationsstruktur nur minimal kühler sind als ihre Umgebung, werden sie im Sommer zu kühlen Oasen. An Tagen mit über 30 °C kann die Lufttemperatur in den Grünflächen bis zu 4 °C geringer sein. Dieser Kühlungseffekt hängt mit der Vegetationsstruktur und Größe der Grünfläche zusammen. Im Allgemeinen gilt: Je größer die Grünfläche, desto stärker ist die Kühlungswirkung. Eine strukturell komplexe, dichte und vielschichtige Vegetation in den Grünflächen kann bis zu einem gewissen Grad für fehlende Größe kompensieren. Unsere Ergebnisse zeigen, dass kleine Grünflächen mit einer hohen Strukturvielfalt potenziell stärker kühlen können als große Grünflächen mit niedriger Strukturvielfalt.
In den untersuchten Grünflächen konnten wir insgesamt 57 verschiedene Gehölzarten kartieren. Die häufigste Art ist die Gemeine Esche, gefolgt von Spitz- und Bergahorn. Im Zeitraum von März bis Mai wurden 37 Vogelarten gezählt. Die Rabenkrähe wurde am häufigsten beobachtet, aber auch einige Vogelarten, die in der Stadt typischerweise nicht zu erwarten sind. Dazu zählt der Waldlaubsänger. Dieser Vogel ist ein Zeiger für großflächige Laubwälder und wird auf der Rote Liste Bayern als "stark gefährdet" eingestuft. Auf dem Durchzug hat der Zugvogel unsere Forschungsflächen als Zwischenstopp genutzt.
Um zu verstehen, wie Besuchende die verschiedenen öffentlichen Parks in München wahrnehmen, wie sie sie nutzen, wofür sie sie schätzen und wie sie sich während ihres Aufenthalts fühlen, führten wir zwischen Juli 2023 und August 2024 standardisierte Sozialbeobachtungen und Befragungen auf den städtisch verwalteten der Projektflächen (51 Plots) durch. Die ersten Die Ergebnisse der Befragung mit 547 Teilnehmenden zeigen insbesondere Unterschiede in der berichteten Erholung, in Abhängigkeit von der Größe einer Grünfläche sowie von der strukturellen Komplexität der Gehölzvegetation. Besonders Flächen mit mittlerer und hoher struktureller Komplexität erzielten höhere durchschnittliche Werte auf der Erholungsskala als Flächen mit niedrigerer Komplexität. Mittlere und große Flächen erzielten im Durchschnitt höhere Erholungswerte als kleine Flächen, wobei der Unterschied moderat bleibt. Wir arbeiten aktuell an der Differenzierung, welche soziodemografischen, situativen und vegetationsbezogenen Merkmale jeweils den berichteten Erholungswert sowie das Nutzungsverhalten begünstigen. Angesichts der erwarteten Zunahme von klimatologischen Sommertagen (maximale Lufttemperatur ≥ 25 °C) und Hitzetagen (maximale Lufttemperatur ≥ 30 °C) in München ist die Rolle des thermischen Komforts in diesem Zusammenhang besonders spannend. Als zentrale Messgröße, um das gesundheitsschützende Potenzial einer Grünfläche festzustellen und als Faktor, der wiederum den berichtete Erholungswert einer Fläche sowie das Nutzungsverhalten, das wiederum langfristige Gesundheitsvorteile impliziert, beeinflussen kann. Die nächsten Schritte für die Forschung sind die Vertiefung der integrativen sozio-ökologischen Analysen, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten.